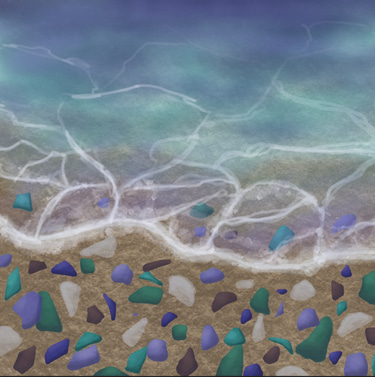Möwen im Wind - Zwei Texte, eine Stimme
Werkstattbericht über zwei Seeglas-Texte, die gemeinsam bestehen
WELLENRAUSCHEN
Leander Linnhoff
1/21/20262 min read


Manche Texte entstehen aus einem Moment.
Andere aus einem nagenden Drang.
Die Möwen sind aus einem solchen Drang entstanden.
Aus tatsächlichen Möwenrufen, die ich in den Herbstferien in Oostende gehört habe und die mich seitdem nicht mehr loslassen. Von den frühen Morgenstunden an waren sie da, begleiteten den Tag und hörten auch nachts nicht auf. Ein ständiges Rufen, Lachen, Kreischen, das irgendwann nicht mehr Kulisse war, sondern Präsenz.
Mit der Zeit begann sich das Geräusch zu verwandeln.
Es blieb nicht beim Hören. Es wurde Beobachtung. Ich habe mich gefragt, worüber diese Tiere sich unterhalten. Was ihnen so viel Freude bereitet, dass sie so viel lachen. Gleichzeitig sah ich sie am Strand als kleine Gangster: wie sie sich um Beute stritten, um Kleintiere, um Fritten, um Chips. Ausgelassen. Rücksichtslos. Lebendig. Nicht aus Bosheit, sondern aus Lebenshunger, aus Bewegung, aus Dasein.
Der Text ist nicht geplant entstanden.
Er war zuerst Geräusch, dann Bild, dann etwas, das sich festgesetzt hat.
In einer der Episoden wird ein junger Pfarrer genannt. Ein konkreter Name. Ein Gässchen.
Auffällig ist dabei weniger das, was erzählt wird, als das, was ausgespart bleibt. Es gibt keine explizite Handlung, kein beschriebenes Geschehen. Und dennoch entsteht beim Lesen oft ein Bild von Schuld, von Grenzüberschreitung, von etwas Unausgesprochenem.
Es ist durchaus möglich, dass nichts vorgefallen ist.
Der Text legt das nicht fest.
Aber durch die Benennung – eines Namens, eines Ortes – beginnt der Leser, ein Narrativ zu entwerfen. Die Vorstellung entsteht nicht aus der Handlung, sondern aus Erwartung und kulturellem Wissen. Der Text hält sich zurück. Das Denken des Lesers tritt vor.
Der Wind ist ganz anders entstanden.
Er entstand an einem Tisch in einem Café in Bonn. Ich saß dort, hatte Zeit, nichts weiter vor. Kein Anlass, kein Thema, kein innerer Druck. Nur der Gedanke: Du hast Zeit – also schreibst du etwas.
Und dann war dieser Text da.
Die beschriebene Natur ist darin kein bloßes Außen.
Sie ist Spiegel – zunächst meiner eigenen Zustände, meiner Wahrnehmung, meiner Beweglichkeit oder Unruhe. Der Wind, das Vorüberziehen, die Veränderung sind weniger Landschaft als Resonanz. Nicht als Symbol, sondern als Erfahrung: Das, was gesehen wird, trägt immer auch den Sehenden in sich.
Gleichzeitig bleibt dieser Wind offen.
Er lässt sich lesen. Er bietet sich an. Wer ihn liest, kann sich in ihm wiederfinden, eigene Bewegungen, eigenes Weitergehen, eigenes Loslassen hineindenken. Die Natur gehört hier weder nur dem Autor noch nur dem Text – sie wird zum gemeinsamen Raum zwischen Schreiben und Lesen.
Der Text wollte nichts festhalten.
Er wollte nichts absichern.
Der Wind durfte einfach Wind sein: Richtung, Veränderung, Vorübergehen.
Vielleicht gehören diese beiden Texte zusammen, gerade weil sie so unterschiedlich entstanden sind.
Der eine aus einem Ort, der nicht verstummt ist.
Der andere aus einem Moment, der nichts verlangt hat.
Beide klingen im selben Resonanzraum. Ich könnte sie mir gut als Teil eines gemeinsamen Bandes denken.
Manchmal entsteht ein Text aus dem Bleiben.
Manchmal aus dem Weitergehen.
Kontakt
Schreib mir deine Gedanken und Fragen jederzeit.
leander.linnhoff@seeglas-lyrik.de
© 2025. All rights reserved.